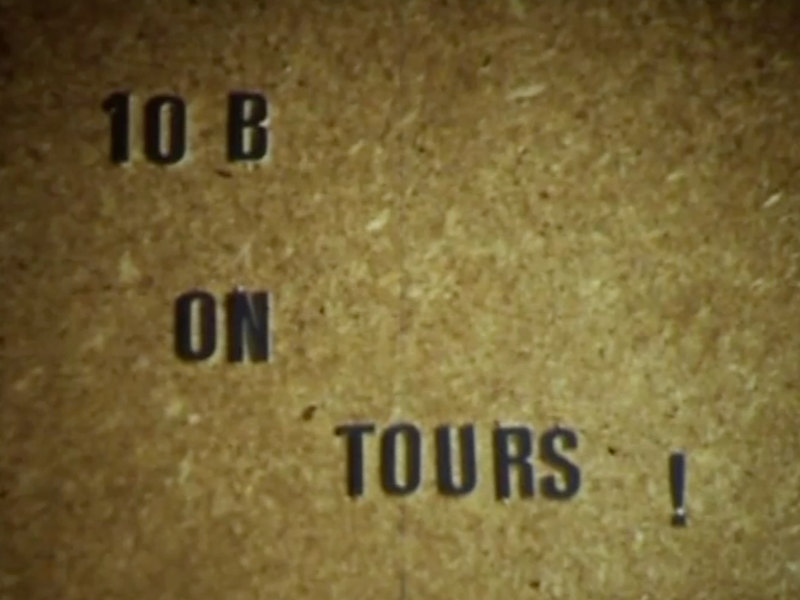Rolf Hauschild wuchs in Hamburg-Sasel auf, nur wenige Gehminuten vom GOA entfernt, das er nach der Grundschule besuchte und 1977 mit dem Abitur verließ. Schon in der Unterstufe zeichnete sich sein Interesse für Medien und Geschichten ab – erste Super-8-Kamera-Erfahrungen sammelte er mit Freunden wie Peter Fürste und Thomas Scheliga. Seine Begeisterung für das bewegte Bild wurde durch den jungen Kunstlehrer Dieter Staacken gefördert, der Filmprojekte aktiv unterstützte und Raum für Kreativität schuf.
Im Zentrum seiner Schulzeit stand nicht nur der Unterricht, sondern auch ein enges soziales Gefüge: Hauschild war Teil einer lebendigen Klassengemeinschaft, die gemeinsam Filme drehte, Ausflüge unternahm und Projekte entwickelte. Bereits in der 9. Klasse entstand eine humorvolle Parodie auf Aktenzeichen XY ungelöst, gefolgt von der filmischen Dokumentation einer Klassenfahrt nach Willingen. Später produzierte Hauschild mit Freunden satirische Kurzfilme und den ambitionierten Streifen Ausbruch, der auf Schülerfilmfestivals in Hamburg und Oberhausen gezeigt wurde (dazu unten mehr).
Die Filme dieser Zeit spiegeln nicht nur die Lebenswelt der Schüler, sondern auch ihren kritischen Blick auf Schule, Medien und Gesellschaft. Ob Werbeparodie, Trickfilm oder Schuldrama – Hauschilds Schulzeit war geprägt von filmischem Erzählen, Improvisation und dem festen Willen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen.